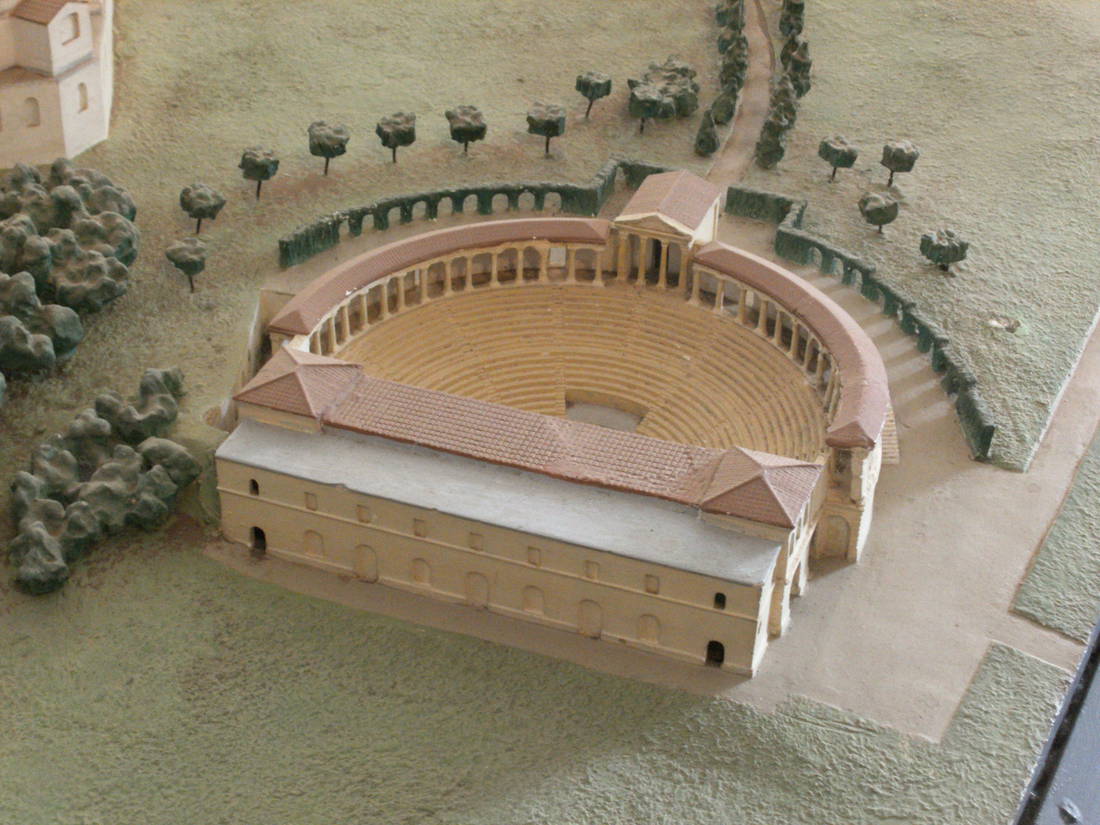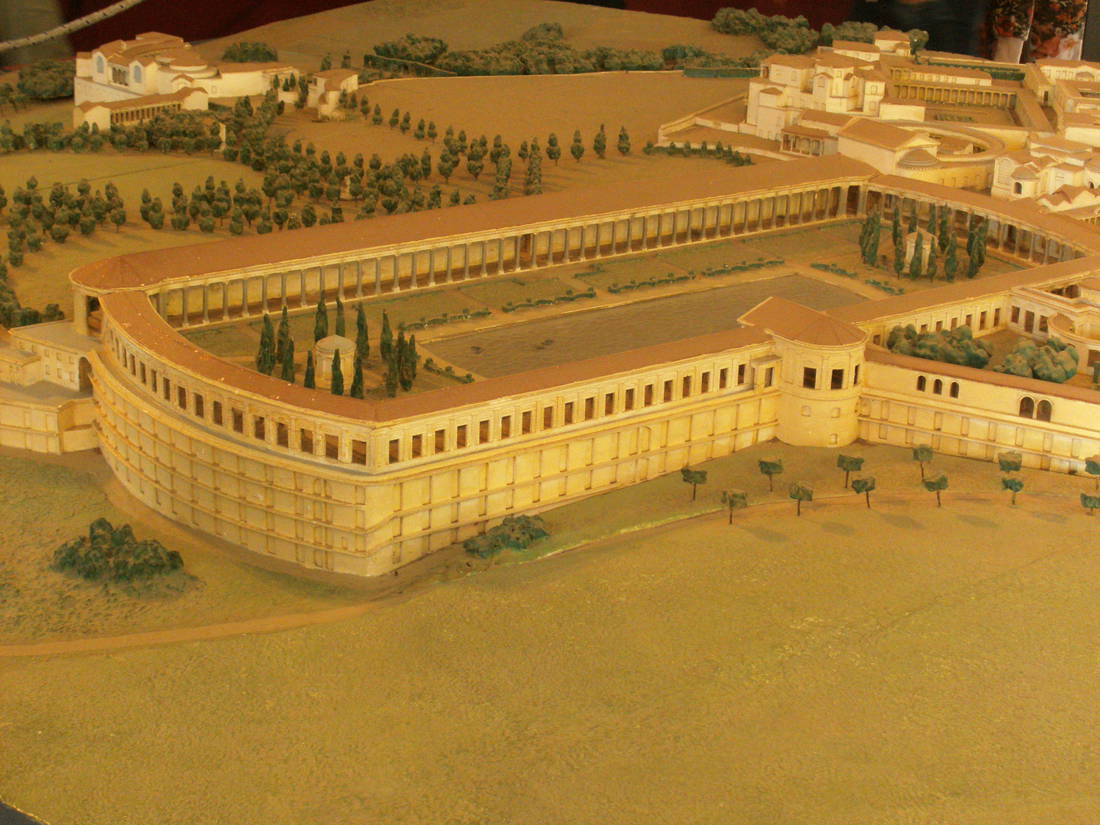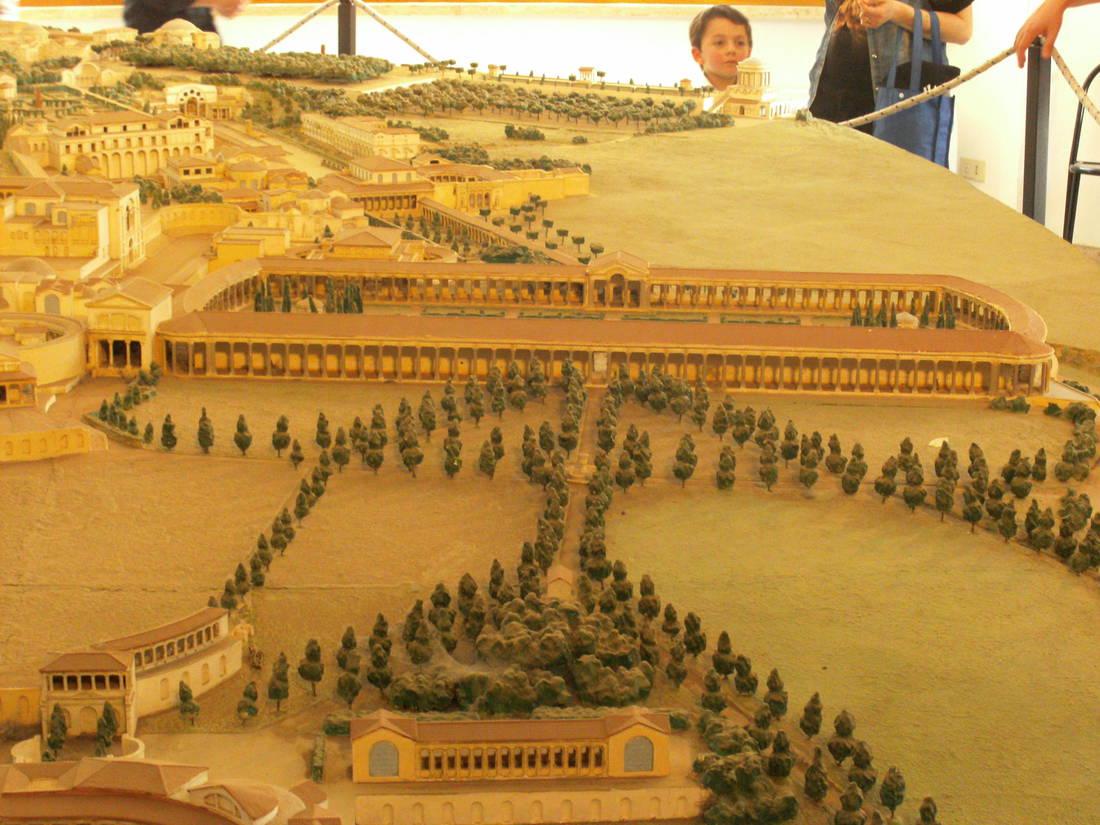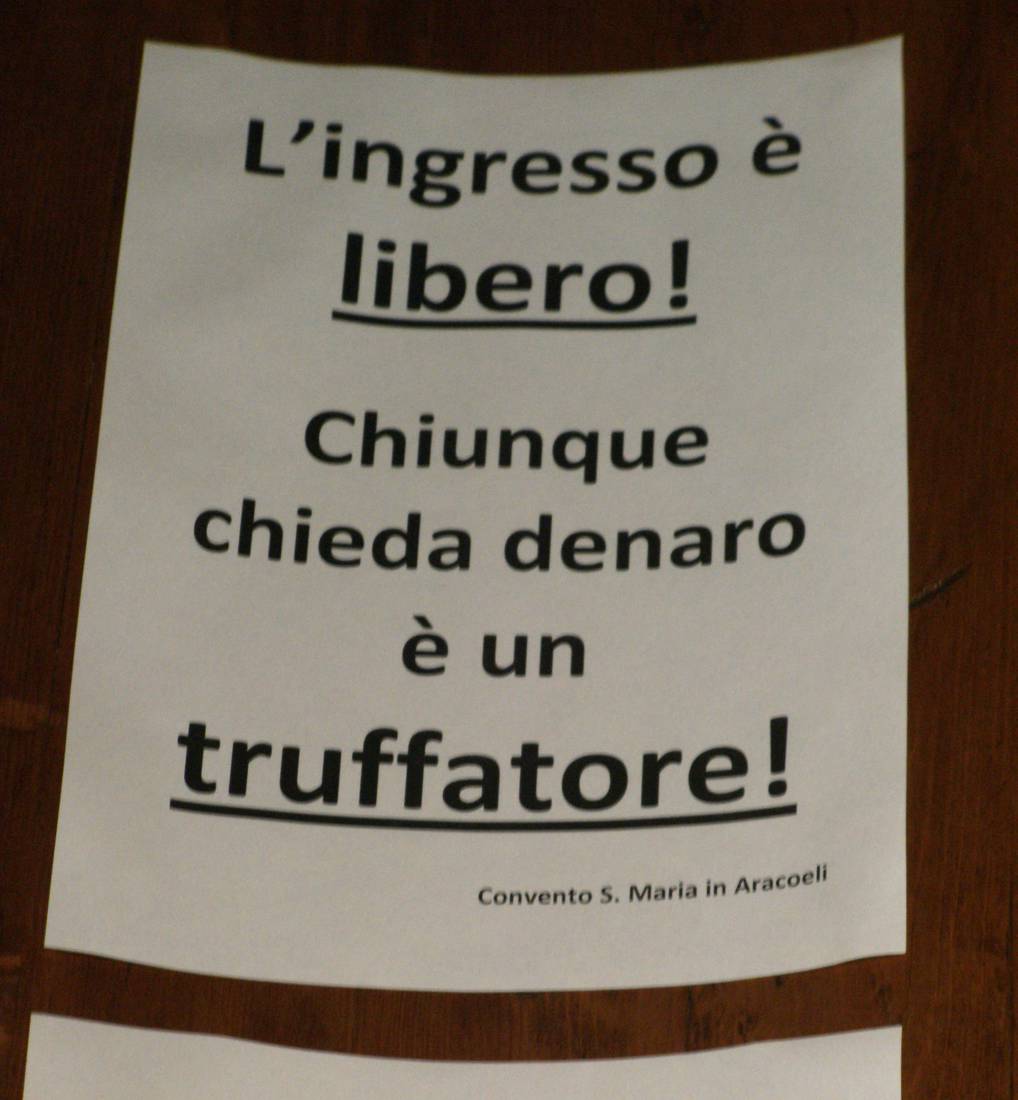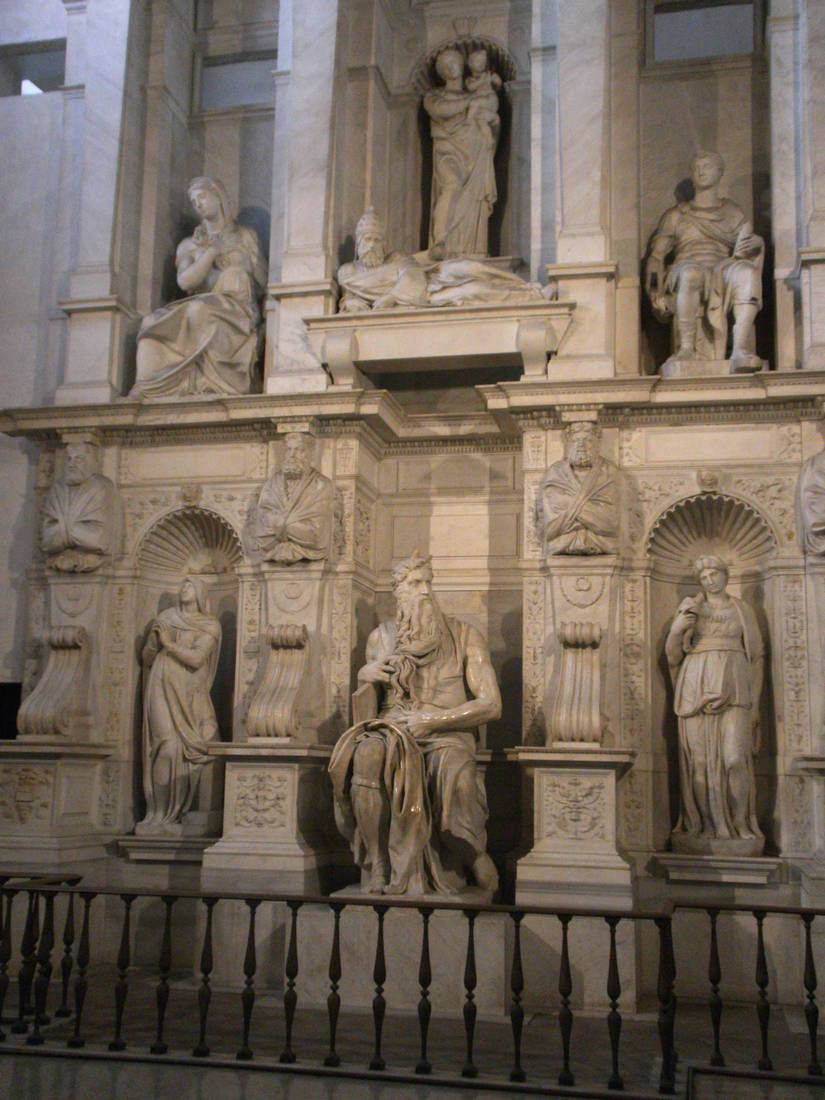Tante Helga
Civis Romanus
Es ist wirklich herrlich mit euch Romprofis mitzulesen und Eindrücke durch die tollen Fotos zu bekommen.
Bald kann ich mir ja vieles mit eigenen Augen ansehen.
Vielen Dank
Bald kann ich mir ja vieles mit eigenen Augen ansehen.
Vielen Dank